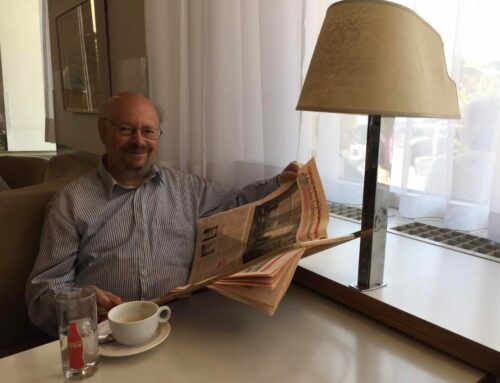Einführung in das Manifest für eine ökosozialistische Revolution
von Maral Jefroudi, 31. Oktober 2025
Präsentationen der Vierten Internationalen Manifest für eine ökosozialistische Revolution – mit dem kapitalistischen Wachstum brechen bei einer Diskussion für Wissenschaftler und Führungskräfte, Aktivisten sozialer Bewegungen und politischer Organisationen, gemeinsam organisiert von IIRE-Philippines (1) und Partido Manggagawa (2). im September 2025 von Maral Jefroudi „Einführung in das Manifest für eine ökosozialistische Revolution: Weniger arbeiten, besser leben” unten und Daniel Tanuro Manifest für eine ökosozialistische Revolution: Mögliche Folgen für die Philippinen”.
Das ökosozialistische Manifest ist das Ergebnis eines dreijährigen gemeinsamen Schreib-, Diskussions- und Überarbeitungsprozesses und ein Gemeinschaftswerk der 4. Internationale. Es baut jedoch auf jahrelangem kritischem marxistischem Denken auf, das eine ökonomisch deterministische Lesart von Marx und ein stufenweises oder mechanistisches Verständnis einer Theorie des revolutionären Wandels ablehnt. Es basiert auch auf dem kollektiven Wissen, das seit Jahrzehnten von sozialistischen Feministinnen, insbesondere denen, die sich mit der Theorie der sozialen Reproduktion beschäftigen, erarbeitet wurde. So können wir das Manifest als eine klare und wissenschaftliche Untersuchung des historischen Moments betrachten: der Katastrophe, in der wir leben, in Kontinuität mit und als Teil einer emanzipatorischen Tradition.
Doch das Manifest geht noch weiter. Es bricht formell und ohne Umschweife mit der kapitalistischen produktivistischen Vorstellung von Wachstum, regt eine lebhafte Debatte über die Bedürfnisse und Prioritäten von Gesellschaften an und schlägt demokratische, kollaborative Wege vor, dies zu erreichen, ohne die Stimme der Marginalisierten dem „höheren Wohl” unterzuordnen. All dies tut es, während es betont, dass Wirksamkeit und Demokratie nicht gegeneinander ausgespielt werden müssen. Im Folgenden möchte ich einige dieser Kontinuitätspunkte und den Ruf nach Demokratie beim Aufbau des „guten Lebens”, für das das Manifest eintritt, näher erläutern.
Die klare Kontinuität des Manifests mit dem marxistischen Feminismus zeigt sich darin, dass es das gute Leben und die freie Zeit in den Mittelpunkt seiner Vision für eine zukünftige Gesellschaft stellt. Marxistische Feministinnen, die sich mit der Theorie der sozialen Reproduktion beschäftigen, haben den Kapitalismus durch die Linse der Arbeitskraft, ihrer Produktion und Reproduktion betrachtet. Während uns Diskussionen über produktive und unproduktive Arbeit jahrelang beschäftigt haben, um den Platz der Reproduktionssphäre im Kapitalismus zu verstehen, blieb die Familie als Kerninstitution dieser Reproduktionssphäre bestehen, in der Arbeitskraft zu möglichst geringen Kosten reproduziert wird und Fürsorge ausschließlich, aber nicht ausreichend für diejenigen geleistet wird, die ihr angehören. Das Entstehen und Zerfallen von Arbeiterfamilien ist ein fortwährender Prozess.
Arbeitskraft ist, wie Marx es ausdrückt, eine „besondere Ware”, die insofern einzigartig ist, als ihre Produktion und Reproduktion größtenteils außerhalb der kapitalistischen Produktionssphäre stattfindet: zu Hause. Die Besonderheit der Arbeitskraft hat viele Aspekte. Im Gegensatz zu anderen Waren, die für den Markt produziert werden, ist die Reproduktion selbst in den dystopischsten Krisenzeiten noch keine arbeitsmarktorientierte Tätigkeit geworden. Eine besondere Ware, die auch nach dem Tausch bei ihrem Verkäufer verbleibt.
Stattdessen beobachten wir einen Prozess der Ökonomisierung von Arbeit und Land, einen ständigen Prozess, der wie viele Aspekte der kapitalistischen Produktionsweise (d. h. die formale/reale Subsumption der Arbeitsverhältnisse) noch nicht vollständig realisiert ist. Ein Prozess, der seit den Anfängen des Kapitalismus auf Widerstand stößt: Widerstand gegen die Privatisierung von Gemeingütern, Kämpfe indigener Völker um ihr Land, Kämpfe der Arbeiter*innen für den 8-Stunden-Tag, Sozialrechte usw. Ein Prozess der Anhäufung von Reichtum durch die Ausbeutung von Mehrwert, der mit einer kontinuierlichen Enteignung (von Menschen von Gemeingütern, von Frauen ihrer Fähigkeiten usw.) einhergeht.
Marx‘ Arbeitswerttheorie führt uns zur zentralen Bedeutung des politischen Kampfes für die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft in Bezug auf das Lohnverhältnis. Kurz gesagt, gemäß der Arbeitswerttheorie bestimmt die „gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit” zur Herstellung einer Ware deren Wert. Es handelt sich um gesellschaftlich notwendige Zeit, da es sich um eine Variable handelt, die von Zeit und Ort abhängt und nicht von individuellen Fähigkeiten. Während es einfacher ist, zu bestimmen, wie viele Stunden abstrakter Arbeit erforderlich sind, um eine Kaffeetasse herzustellen, selbst in ihrer extravagantesten Form, muss das, was für die Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist, definitiv noch weiter diskutiert werden. Marx sagt, dass es in diesem Zusammenhang das „Zivilisationsniveau” ist, das ausschlaggebend ist. „Ja, wir kämpfen um Brot, aber wir kämpfen auch um Rosen”, zitiert das Manifest. „Ein gutes Leben für alle erfordert, dass die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse – gesunde Ernährung, Gesundheit, Unterkunft, saubere Luft und sauberes Wasser – erfüllt werden. Ein gutes Leben ist auch ein selbstbestimmtes Leben, erfüllend und kreativ …“ Wenn wir anerkennen, dass der Klassenkampf untrennbar mit der Entstehung der Arbeiterklasse selbst verbunden ist und dass er nicht zweitrangig gegenüber den objektiven Bedingungen des Arbeiterdaseins ist, dann sprechen wir über den Kampf um ein Leben, das für einen Arbeiter gut genug ist. Es ist nicht möglich, zu bestimmen, wie viel sozial notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderlich ist, wenn wir uns nicht darüber einig sind, wie die Bedingungen dieses Lebens aussehen. Das Manifest fordert eine Debatte über die Bedürfnisse der Gesellschaft, eine Debatte, die lokal stattfinden muss, eine Debatte, die die materiellen Grenzen der Ressourcen anerkennt und dennoch die Bedürfnisse der Marginalisierten und Minderheiten nicht dem „gemeinsamen Nenner“ der Mehrheit unterordnet.
Der ökosozialistische Kampf muss feministisch und antirassistisch sein
Auch wenn wir wissen, dass der Kapitalismus weder die Unterdrückung der Geschlechter noch den Rassismus erfunden hat, sind wir sicher, dass er die derzeitige rassistische und sexistische Konstellation der Machtverhältnisse für seine eigenen Zwecke genutzt hat. Durch die Trennung der Sphäre der Produktion von der Sphäre der Reproduktion in einer Weise, die im Vergleich zu früheren Klassengesellschaften beispiellos ist, und durch die historische Verdrängung der Frauen in die Sphäre der Reproduktion, wo sie die für die Reproduktion des Lebens notwendige Arbeit verrichten oder zumindest die Hauptverantwortung für deren Organisation übernehmen, hat der Kapitalismus dazu beigetragen, die aktuelle Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu prägen, die nicht nur Frauen unterdrückt, sondern auch LGBTQI+-Personen und andere, die kein Leben führen, das den Normen der Familie entspricht, die darauf ausgerichtet ist, Arbeitskraft zu möglichst geringen Kosten zu reproduzieren. Frauen sind nicht nur die Hauptproduzentinnen des Lebens im häuslichen Bereich, sie stellen auch die Mehrheit der Pflegekräfte weltweit. Ob bezahlt oder unbezahlt, Pflegearbeit wird also überwiegend von Frauen geleistet. Mit dem Vorschlag, Pflegearbeit zu sozialisieren, meint das Manifest einfach, dass sie zur Aufgabe aller werden soll. Bei der Neuorganisation der Aktivitäten im Zusammenhang mit der sozialen Reproduktion wird auch betont, dass diese Neuorganisation darauf achten wird, keine Geschlechterstereotypen zu reproduzieren. Denn obwohl es Unterschiede zwischen den Menschen gibt und auch weiterhin geben wird, ist es die soziale Organisation dieser Unterschiede, die unterdrückerische Systeme schafft, nicht die Unterschiede selbst.
Daher ruft das Manifest zu einem feministischen, antirassistischen Kampf auf, nicht nur, weil wir gegen alle Formen der Unterdrückung sind, sondern auch, weil wir wissen, dass diese Unterdrückungen untrennbar mit dem Funktionieren des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, verbunden sind. Ob der Kapitalismus Geschlechterunterdrückung oder Rassismus braucht, um zu funktionieren, ist eine Frage der politischen Theorie. Was wir wissen, ist, dass es keine historische Epoche im Kapitalismus gab, in der er nicht rassistisch oder sexistisch war, und daher muss der antikapitalistische Kampf auch antirassistisch und antisexistisch sein. Von der anfänglichen Kapitalakkumulation, die durch Sklaverei und Plünderung zum industriellen Kapitalismus führte, bis hin zur Umgestaltung der industriellen Reservearmee auf der Grundlage der Machtverhältnisse der damaligen Zeit, indem marginalisierte Teile der Gesellschaft gegeneinander ausgespielt wurden, hat die kapitalistische Organisation der Arbeitsbeziehungen dazu beigetragen, geschlechtsspezifische und rassistische Identitäten zu schaffen.
Wenn Marx in „Das Kapital“ Band 1 die Grenzen des Arbeitstages diskutiert, führt er das Beispiel der Sklaverei und der Plantagen an, um Situationen zu veranschaulichen, in denen der Versuch, durch Verlängerung des Arbeitstages „absoluten Mehrwert“ zu schaffen, ohne Einschränkungen funktionieren kann. Eine Verlängerung des Arbeitstages über das gesellschaftlich Akzeptierte hinaus ist nur möglich, wenn die Produktion über die Befriedigung lokaler Bedürfnisse hinausgeht und sich ausschließlich auf die Produktion von Mehrwert konzentriert. Eine Verlängerung des Arbeitstages ist nur möglich, wenn der Ersatz der Arbeitskraft als profitabler angesehen wird als deren Reproduktion. Nur wenn Arbeitskraft (also Menschen) als Ware auf dem Weltmarkt gekauft werden kann (z. B. Sklavenhandel) und vollständig aus ihrem sozialen Netzwerk herausgelöst ist, kann auf die Reproduktion ihrer Fähigkeiten verzichtet werden. Die Geschichte des industriellen Kapitalismus in Europa offenbart diese doppelte Haltung (lokal/entwurzelt) gegenüber der Arbeit. Eine moderne Version dieses rassistischen Ansatzes gegenüber Arbeit, der die Zusammensetzung der industriellen Reservearmee und die Entstehung von Überschussbevölkerungen prägt, lässt sich in landwirtschaftlichen Betrieben beobachten, in denen Saisonarbeiter ohne Papiere beschäftigt werden, in Textilwerkstätten, in denen Flüchtlinge ohne Papiere arbeiten, oder in der Hausarbeit, wo ausländischen Pflegekräften, fast ausschließlich Frauen, ihre Pässe von ihren Arbeitgebern abgenommen werden.
Unser größter Reichtum: Freie Zeit
Die Priorität des Kapitalismus besteht nicht darin, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern Profit zu erzeugen. Wir wollen ein Produktionssystem, das die Bedürfnisse der Menschen und nicht den Profit in den Vordergrund stellt, denn nur so können wir auf diesem Planeten überleben. „Wahrer Reichtum liegt nicht in der unendlichen Vermehrung von Gütern – Haben –, sondern in der Vermehrung von freier Zeit – Sein“, heißt es im Manifest. Dieser Zustand des Seins, des Existierens, erfordert nicht nur den Zugang zu den Grundbedürfnissen für die Reproduktion der Arbeitskraft, sondern auch die Freizeit, um ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Das Manifest fordert, die Freizeit aus ihrer Rolle als Restkategorie zu befreien. Nicht als das, was von der Arbeitszeit übrig bleibt, sondern als Selbstzweck, als wichtigste Ressource, die notwendig ist, um gemeinsam ein sinnvolles Leben aufzubauen. Wir tragen also tatsächlich die historische Fahne des Kampfes um die Verkürzung des Arbeitstages. Wir brauchen Freizeit, um neue Fähigkeiten zu erlernen, uns gegenseitig zu helfen, uns sinnvoll zu betätigen und Gemeinschaften aufzubauen. Befreite Zeit ist die notwendige Voraussetzung für die Durchführung kollektiver, inklusiver und demokratischer Beratungsprozesse, die unsere Gesellschaft organisieren werden. Das Manifest stellt fest, dass „der ökosozialistische Bruch eine doppelte Transformation der Arbeit mit sich bringen wird: Quantitativ werden wir weniger arbeiten, qualitativ wird er die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Arbeit zu einer Aktivität des guten Lebens wird – zu einer bewussten Vermittlung zwischen den Menschen und dem Rest der Natur.“
Während die derzeitigen Lohnverhältnisse, die ständige Schaffung von Mehrwert, die Trennung von Produktions- und Reproduktionssphären und die Unsichtbarmachung dessen, was in letzterer geschieht, Klassenverhältnisse sowie Machtdynamiken reproduzieren, die durch spezifische Unterdrückungen geprägt sind, liegt der Weg aus dieser Situation in den Erfahrungen, die durch diese Verhältnisse der Ausbeutung und Unterdrückung geprägt sind. Das Manifest unterstreicht die Bedeutung der Selbstorganisation marginalisierter Gemeinschaften und Teilen der Gesellschaft und die Einbeziehung des aus diesen Erfahrungen gewonnenen Wissens in kollektive Entscheidungsprozesse. Menschen mit Behinderungen, Frauen, rassifizierte Menschen, einschließlich Migrant:innen und indigene Bevölkerungsgruppen, sind Akteure des Wandels, für den wir kämpfen.
Eine der Hauptstärken des Manifests liegt darin, dass es die Beziehung zwischen der Ausgrenzung marginalisierter Teile der Gesellschaft und der Entscheidung darüber, was gut für die Gesellschaft ist, aufzeigt. Die Menschen, die vom derzeitigen System am stärksten betroffen sind, sind auch diejenigen, die systematisch von der Gestaltung und Umsetzung seiner Politik ausgeschlossen werden. Diese Feststellung geht mit einem starken Bekenntnis zur Demokratie einher. Es gibt kein Patentrezept, das für alle passt. Jeder spezifische Kontext hat seine eigenen Probleme und Prioritäten. Das Prinzip „so viel Dezentralisierung wie möglich, so viel Koordination wie nötig” und die Organisation inklusiver, demokratischer Beratungsprozesse sind jedoch unverzichtbar für den Wandel, für den wir uns einsetzen. Durch diese Prozesse können Entscheidungen darüber getroffen werden, was innerhalb der Grenzen der materiellen Ressourcen produziert werden soll und wie dies geschehen soll. Ein weiterer wichtiger Punkt im Manifest: Wenn das Manifest die Notwendigkeit der Konvergenz von Kämpfen diskutiert, wird betont, dass das Ziel nicht darin besteht, einen „größten gemeinsamen Nenner“ in Bezug auf Forderungen zu erreichen, was zum Nachteil der am stärksten marginalisierten Gruppen sein kann. Die Konvergenz von Kämpfen ist „ein Prozess der dynamischen Artikulation, der durch Aktion und Debatte in gegenseitigem Respekt das Bewusstsein schärft“.
Wann immer ein revolutionäres Projekt diskutiert wird, kommt man unweigerlich auf die Frage nach Utopie oder Realismus zu sprechen. Sprechen wir über eine Welt in der Zukunft oder über das Hier und Jetzt? Das Manifest geht vom Hier und Jetzt aus und schlägt konkrete Forderungen vor, die den Weg für einen revolutionären Wandel ebnen. Es ist richtig, dass unsere Vorstellungskraft durch die sozialen Bedingungen, in denen wir leben, unsere Geschichte und die vorherrschende Ideologie begrenzt ist. Doch selbst innerhalb dieser Grenzen werden wir uns unserer Fesseln bewusst, indem wir uns bewegen. (Rosa Luxemburg)
Durch die detaillierte Darstellung der ökosozialistischen Alternativen, darunter unter anderem öffentliche Katastrophenschutzpläne, Ernährungssouveränität, die Vergesellschaftung von Energie, Finanzen und Big Tech, Beschäftigungsgarantie, Bildungsreform und die Ausweitung der Gemeingüter, unterstreicht das Manifest die Bedeutung von Übergangsforderungen, die das System mit Blick auf eine ökosozialistische Zukunft vorantreiben. Das Bekenntnis zur Demokratie ist nicht nur eine Frage des Idealismus. Wir wissen, dass die marginalisierten Teile der Arbeiterklasse, darunter unter anderem Frauen, Queers, indigene Bevölkerungsgruppen, Migrant:innen und Menschen mit Behinderungen, die Krisen des Kapitalismus stärker zu spüren bekommen als andere. Wenn sie aus den individualisierten Fallen des Systems, aus Schuld und Versagen, befreit und durch kollektive Beratung und Organisation neu aufgebaut werden, sind es diese Erfahrungen, die unsere Perspektive für die Vorstellung und den Aufbau von Alternativen leiten werden.
Wir sind uns auch bewusst, dass wir ohne eine umfassende Systemänderung keine Inseln im Kapitalismus schaffen können, aber wir unterschätzen nicht die konstruktive Kraft der Erfahrungen, die Beispiele für postkapitalistische Beziehungen in der heutigen Welt in Form von lebendigen Gemeinschaften, Genossenschaften, Streikausschüssen usw. vorstellen und zu schaffen versuchen. Selbst wenn sie auf lange Sicht scheitern sollten, bereichern sie unsere kollektive Vorstellung von einer postkapitalistischen Welt. Wir tun dasselbe, es ist nicht das erste Mal, dass Revolutionäre über die Vergesellschaftung mühsamer Aufgaben oder die soziale Reproduktion sprechen. Auch die frühen russischen Revolutionäre hatten sich kollektive Kantinen, die Vergesellschaftung der Kinderbetreuung und den Bruch mit der traditionellen Familie vorgestellt, insbesondere durch die Arbeit von Alexandra Kollontai und ihren Genossinnen und Genossen. Diese Erfahrung ging in den 1930er Jahren mit der stalinistischen Konterrevolution verloren, aber sie bleibt uns erhalten und hat uns geholfen, unsere eigenen Alternativen zu entwickeln. Das Manifest ist sich bewusst, dass man Menschen nicht allein mit Argumenten überzeugen kann. Teilerfolge machen den Menschen Mut.
Unser Slogan ist leicht zu verstehen und zu unterstützen: „Weniger arbeiten, besser leben und arbeiten, ein gutes Leben führen.“ So einfach er auch ist, er löst überall, wo wir sind, eine lebhafte Debatte darüber aus, was ein gutes Leben auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen bedeutet. Was sollten unsere Prioritäten sein, welche Alternativen gibt es zu den Institutionen, die wir abschaffen wollen? Wie wollen wir sie aufbauen? Das Manifest enthält sicherlich viele Antworten auf die ökologische Katastrophe, die wir derzeit erleben, und es ermutigt die Gemeinschaften, hier und jetzt gegen diese Zerstörung zu kämpfen. Aber es geht auch darüber hinaus, indem es uns alle ermutigt, gegen die Normen der kapitalistischen Gesellschaft für ein gutes Leben zu kämpfen und diese ideologische Blockade zu durchbrechen, indem wir unsere Alternativen vorschlagen.