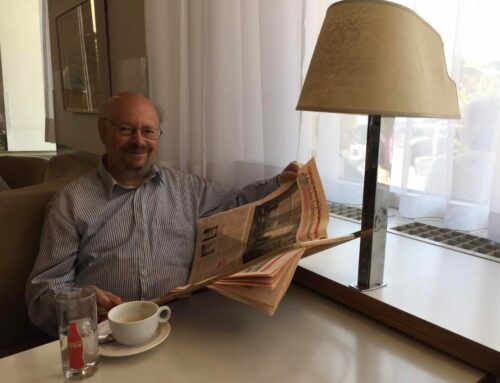von Daniel Tanuro 20. August 2025
Seit mehr als zwanzig Jahren stellen sich revolutionäre Marxisten die Frage: War ihr verpasstes Rendezvous mit der Ökologie in den 60er bis 90er Jahren des letzten Jahrhunderts Marx und Engels zuzuschreiben? Wenn ja, inwieweit? Zu diesem Thema wurden Hunderte von Seiten geschrieben. Auch wenn die von J.B. Foster vertretene These einer „Marxschen Ökologie” etwas übertrieben ist, wagt heute niemand mehr ernsthaft zu behaupten, dass die Verfasser des Kommunistischen Manifests Produktivisten waren, die Technologie fetischisierten und keine Vorstellung von den Grenzen der Natur hatten…
Warum fanden ihre Umweltbelange danach so wenig Resonanz? Der Sieg der Revolution in einem peripheren Land – verbunden mit den Forderungen nach einem sogenannten „rattrapage” („Aufholen” des Entwicklungsstands der zentralen kapitalistischen Länder, Anmerkung des Übersetzers) und den neuen Möglichkeiten einer zentralisierten Politik, die auf radikale Transformation abzielte – war sicherlich für einen Großteil der monströsen Schäden des stalinistischen Produktivismus verantwortlich. Es wäre jedoch falsch, alles auf die Stalinisierung der UdSSR zurückzuführen: Die Begeisterung für die Möglichkeit, die Wissenschaft in den Dienst progressiver Transformationen zu stellen, war zweifellos nicht umsonst Teil des grenzenlosen technowissenschaftlichen Optimismus – weit entfernt von Marx‘ Vorsicht –, den insbesondere Leo Trotzki zum Ausdruck brachte. Es ist wichtig, darauf zurückzukommen.
Nachdem ökologische Fragen mehrere Jahre lang auf der Tagesordnung standen, ohne dass ihnen ausreichend Gewicht beigemessen wurde, verabschiedete die Vierte Internationale im Februar 2003 eine Resolution mit dem Titel „Ökologie und Sozialismus“ [1]. Im Jahr 2010 verabschiedete sie eine spezifische Resolution zum Klimawandel und sprach sich für den Ökosozialismus aus [2]. Dieser Linie folgend, sollte die Bewegung das Tüpfelchen auf das i setzen: Ihr Gründer hatte das immense Verdienst, sich dem Stalinismus zu widersetzen, was die Weitergabe des marxistisch-revolutionären Erbes an die Nachkriegsgenerationen ermöglichte. Leider war dieses Erbe unvollständig: Die von Marx und Engels entwickelten Instrumente zum Verständnis des Stoffwechsels zwischen Menschheit und Natur waren nicht Teil davon. Dieser Artikel hat keinen anderen Zweck, als darauf hinzuweisen und dies zu erklären, in der Hoffnung, zur Vertiefung der „Ökologisierung des Marxismus” beizutragen.
Eine sehr dominante Herrschaft
„Wir sollten uns jedoch nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur brüsten. Denn für jeden solchen Sieg rächt sich die Natur an uns. Jeder Sieg bringt zwar zunächst die erwarteten Ergebnisse, hat aber in zweiter und dritter Linie ganz andere, unvorhergesehene Auswirkungen, die nur allzu oft die ersten zunichte machen. Die Menschen, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder zerstörten, um Ackerland zu gewinnen, ahnten nicht, dass sie damit die Sammelstellen und Speicher für Feuchtigkeit beseitigten und damit die Grundlage für den heutigen trostlosen Zustand dieser Länder schufen. Als die Italiener in den Alpen die Kiefernwälder an den Südhängen, die an den Nordhängen so sorgfältig gepflegt wurden, abholzten, ahnten sie nicht, dass sie damit die Wurzeln der Milchwirtschaft in ihrer Region zerstörten; noch weniger ahnten sie, dass sie damit ihre Bergquellen für den größten Teil des Jahres ihrer Wasserzufuhr beraubten und es ihnen ermöglichten, während der Regenzeit noch heftigere Sturzfluten über die Ebenen zu schicken. Diejenigen, die die Kartoffel in Europa verbreiteten, waren sich nicht bewusst, dass sie mit diesen mehligen Knollen auch Skrofulose verbreiteten. [3]
Neben anderen Überlegungen zeigt dieses lange Zitat von Engels, dass die Begründer des Marxismus eine dialektische Sichtweise auf den Fortschritt in der Fähigkeit der Menschheit hatten, die Umwelt zu verändern. Trotzki schlägt einen anderen Ton an. In einem Werk aus dem Jahr 1923 schreibt der Gründer der Roten Armee:
„Die gegenwärtige Verteilung von Bergen, Flüssen, Feldern, Wiesen, Steppen, Wäldern und Meeresküsten kann nicht als endgültig angesehen werden. Der Mensch hat bereits Veränderungen in der Landkarte der Natur vorgenommen, die weder geringfügig noch unbedeutend sind. Aber im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, sind dies nur Schüleraufsätze. Der Glaube versprach nur, Berge zu versetzen; aber die Technik, die nichts „auf Glauben“ nimmt, ist tatsächlich in der Lage, Berge abzuhauen und zu versetzen. Bislang geschah dies auf der Grundlage industrieller Überlegungen – Bergwerke, Tunnel usw. In Zukunft wird dies in unermesslich größerem Umfang geschehen, entsprechend weitreichenderen industriellen und künstlerischen Plänen. Der Mensch wird sich mit der Neukartierung von Bergen und Flüssen beschäftigen und ernsthaft und wiederholt Verbesserungen in der Natur vornehmen. Am Ende wird er die Erde neu erschaffen haben, wenn nicht nach seinem eigenen Bild, so doch zumindest nach seinem eigenen Geschmack. Wir haben nicht die geringste Befürchtung, dass dieser Geschmack schlecht sein könnte. (…) Der sozialistische Mensch wird die gesamte Natur (…) mit Hilfe der Maschine beherrschen. Er wird Orte für Berge und Flussläufe bestimmen und Regeln für die Ozeane festlegen.“ [4]
Es stimmt, dass Trotzki, als er diese Zeilen schrieb, Die Dialektik der Natur, die 1925 (auf Deutsch) veröffentlicht wurde, noch nicht gelesen hatte. Aber dieses Werk war den bolschewistischen Führern von 1920-21 zugänglich, da die Manuskripte von Engels in der Obhut der deutschen Sozialdemokraten waren, die sie nach der Oktoberrevolution an die russische Partei übergeben hatten [5]. Darüber hinaus ist anzumerken, dass Trotzki selbst 1923, dem Jahr der Veröffentlichung von Literatur und Revolution, von zahlreichen Texten von Marx und Engels zum Thema Mensch-Natur-Beziehung inspiriert worden sein könnte.
Insbesondere hätte er Marx‘ Warnung vor einer „Kluft im wechselseitigen Prozess des sozialen Stoffwechsels” zur Kenntnis nehmen können – die erste Formulierung des Konzepts, das sich später zu dem entwickelte, was wir heute als „ökologische Krise” kennen. Bereits 1866 schrieb Marx an Engels: „(…) wir haben den unwiderlegbaren Beweis, basierend auf der Geologie usw., dass die Erde selbst nach einer bestimmten Zeit einen natürlichen Tod sterben muss… Aber ich halte es für sehr wichtig, dass Liebigs […] negative Aspekte bekannt gemacht werden. Abgesehen vom Einfluss der Abholzung der Wälder usw. […] auf die Quellen usw., die Tatsache, dass die Bewirtschaftung, wenn sie auf natürliche Weise erfolgt und nicht bewusst kontrolliert wird […], Wüsten hinterlässt (Persien, Mesopotamien usw., Griechenland)“ [6].
Engels hingegen zeigt viel mehr epistemologische Vorsicht. Im Anti-Dühring schreibt er: „Hier haben wir wieder denselben Widerspruch, auf den wir zuvor in Bezug auf den Charakter des menschlichen Denkens gestoßen sind, das notwendigerweise als absolut verstanden wird, und seine Realität in einzelnen Menschen mit offensichtlich begrenztem Denken; dies ist ein Widerspruch, der nur in der unendlichen Abfolge, in der für uns zumindest praktisch unendlichen Abfolge menschlicher Generationen gelöst werden kann. In diesem Sinne ist das menschliche Denken ebenso souverän, wie es nicht souverän ist, und seine Erkenntnisfähigkeit ist ebenso unbegrenzt, wie sie begrenzt ist.“ [7] Lenin greift denselben Gedanken in einfacheren Worten auf: „Wir werden uns der objektiven Wahrheit annähern (ohne sie jedoch jemals erschöpfen zu können)“ [8].
Trotzki ist weniger zurückhaltend. 1925, als er Präsident des Wissenschaftlich-Technischen Rates der Industrie und damit verantwortlich für alle sowjetischen wissenschaftlichen Einrichtungen ist, spricht er vor einem Publikum von Chemikern. In seiner Rede lobt er, basierend auf „technisch-wissenschaftlichem Optimismus“, den großen russischen Wissenschaftler Mendelejew, den Erfinder des Periodensystems der Elemente. Lev Davidowitsch drückt sich begeistert aus: „Mendelejews Glaube an die unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft, seine Weitsicht und seine Beherrschung der Materie müssen zum gemeinsamen wissenschaftlichen Glauben der Chemiker der sozialistischen Heimat werden. Durch den Mund eines ihrer Gelehrten, Du Bois-Reymond, vertraut uns die soziale Klasse, die die historische Bühne verlässt, ihr philosophisches Motto an: „Ignoramus, ignorabimus!“, das heißt: „Wir verstehen nicht, wir werden nie lernen!“ Lüge, antwortet das wissenschaftliche Denken, das sein Schicksal mit dem der aufstrebenden Klasse verbindet. Das Unwissbare existiert für die Wissenschaft nicht. Wir werden alles verstehen! Wir werden alles lernen! Wir werden alles neu aufbauen!“ [9]
Der Wille, den Massen und Militanten Vertrauen in ihre Fähigkeit zu geben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, ist eine Konstante bei Trotzki und drückt sich manchmal auf etwas übertriebene Weise aus. Aber hier geht es um mehr. Tatsächlich ist seine Begeisterung für Mendelejew insbesondere dadurch motiviert, dass der technowissenschaftliche Optimismus des großen Wissenschaftlers als Grundlage für seinen Kampf gegen die Malthusianer diente. Es ist verständlich, dass Trotzki Mendelejew in diesem Punkt unterstützen wollte. Um sich dem Bevölkerungsprinzip zu stellen, brauchte Marx jedoch keinen Glauben an die unbegrenzten Möglichkeiten der Wissenschaft: Er begnügte sich damit, durch eine Reductio ad absurdum festzustellen, dass es schlichtweg unmöglich sei, dass die Bevölkerung die Nahrungskapazitäten der Umwelt übersteige, und dass, wenn Malthus Recht gehabt hätte, d. h. wenn es einen unüberwindbaren Widerspruch zwischen exponentiellem Bevölkerungswachstum und linearem Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion gegeben hätte, dann wäre der erste Mensch auf der Erde bereits einer zu viel gewesen. Argumente dieser Art reichten ihm aus, um zu zeigen, dass der Pastor Malthus Pseudowissenschaft betrieb und dass seine Theorien in Wirklichkeit nichts anderes waren als ein zynischer, widerwärtiger und heuchlerischer Appell gegen die Hilfe für die Armen.
Der Kontrast ist auffällig. Marx‘ Argumentation ist konkret, dialektisch. Die von Trotzki nimmt die Form eines Bekenntnisses zum Glauben an die Wissenschaft mit großem S, an den technologischen Fortschritt mit großem F. In Das Kapital betont Marx, dass die kapitalistische Produktion „die Stoffwechselverhältnisse zwischen Mensch und Erde stört, d. h. verhindert, dass die vom Menschen in Form von Nahrung und Kleidung verbrauchten Bestandteile der Erde wieder in den Boden zurückkehren; sie verletzt damit die notwendigen Bedingungen für eine dauerhafte Fruchtbarkeit des Bodens“ [10]. Für Marx liegt die Lösung für diese Störung nicht in der unbegrenzten Entwicklung der Produktivkräfte, sondern im Übergang zu einer Produktionsweise, die „den rational geregelten Austausch des organischen Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur“ unter „Bedingungen, die ihrer menschlichen Natur am günstigsten und würdigsten sind“ ermöglicht.
Für Trotzki hingegen scheint „die Maschine“ – die Technologie – die magische Lösung für alle Probleme zu sein: „Der sozialistische Mensch wird die gesamte Natur (…) mit Hilfe der Maschine beherrschen“ [11]. Diese Fetischisierung der Technologie ist umso überraschender, als sie im Gegensatz zu der Qualität seiner Analysen in allen anderen Bereichen, insbesondere der politischen Analyse, steht. Es scheint, dass sich der Gründer der Roten Armee in diesem Fall von der futuristischen Begeisterung der damaligen Zeit mitreißen ließ.
Wissenschaft und Technologie: linearer Fortschritt
Es sollte jedoch betont werden, dass diese Fetischisierung nicht spezifisch trotzkistisch war: Sie durchdrang die gesamte Gesellschaft, einschließlich der Arbeiterbewegung. Was Trotzki jedoch von Marx und Engels unterscheidet, ist seine lineare Vorstellung von wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung [12]. Für den Begründer des historischen Materialismus ist die Entwicklung der Produktivkräfte widersprüchlich. Sie dient nicht automatisch und zwangsläufig dem menschlichen Fortschritt – alles hängt von den sozialen Produktionsverhältnissen ab. Marx und Engels wussten zum Beispiel sehr wohl, dass Kapitalisten Innovationen durchaus blockieren können, um ihre Profite zu sichern [13]. Trotzki scheint diese grundlegende Erkenntnis zu ignorieren.
Im selben Werk, Kultur und Sozialismus (1927), schreibt er: „Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik folgt ihrer eigenen inneren Logik, gehorcht ihren eigenen Gesetzen und lässt sich nicht durch politische und soziale Hindernisse aufhalten. Wenn eine wissenschaftliche Entdeckung oder technische Erfindung aufgrund des niedrigen Kulturstands oder ungünstiger sozialer Bedingungen in einem Land nicht sofort Anwendung findet, wird sie in einem anderen Land angewendet werden“ [14]. Das ist kein dialektisches Denken, sondern reiner technologischer Determinismus.
Diese Vision kommt noch deutlicher in dem berühmten Text zum Ausdruck, in dem Trotzki sich ein kommunistisches Amerika vorstellt: „Wenn Amerika kommunistisch würde“ (1934). Er beschreibt die Umgestaltung der Natur in großspurigen Worten: „Die Landkarte Amerikas wird neu gezeichnet werden. Die Wälder werden nach Norden verlegt werden. Die Sümpfe werden trockengelegt, das Klima wird verbessert. Die Gipfel, die im Weg stehen, werden abgetragen. Der Lauf der Flüsse wird verändert. Amerika wird sich von dem, was es heute ist, verwandeln. Die kommunistische Methode der Anwendung von Technologie wird eine neue Geografie schaffen“ [15].
Wieder finden wir denselben imperialen Ton, dasselbe Fehlen jeglichen ökologischen Bewusstseins, denselben blinden Glauben an die Allmacht der Technologie. 1926 geht Trotzki in einer Rede über „Radio, Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft“ noch weiter in seinem technologischen Fetischismus: „Das Radio wird jede noch so abgelegene und isolierte Hütte in ein Organ verwandeln, das für das Leben der gesamten Menschheit empfänglich ist. Das Radio wird den Unterschied zwischen Stadt und Land beseitigen (…)“ [16].
Diese lineare Vision des technologischen Fortschritts steht in scharfem Kontrast zu den differenzierteren Ansätzen von Marx, Engels und sogar Lenin. In „Die Agrarfrage und die Kritiker von Marx“ schreibt Lenin: „Die Technik an sich ist weder fortschrittlich noch reaktionär. Alles hängt von ihrer Anwendung ab, von den sozialen Verhältnissen, in denen sie angewendet wird“ [17].
Sozialistische Eugenik, sozialistische Alchemie
Der technowissenschaftliche Enthusiasmus des Gründers der Roten Armee geht Hand in Hand mit Positionen, die aus heutiger Sicht offen gesagt beunruhigend erscheinen. Noch in Literatur und Revolution schreibt er über den neuen sozialistischen Menschen: „Der Mensch wird unermesslich stärker, weiser und subtiler werden; sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen rhythmischer, seine Stimme musikalischer. Die Lebensformen werden dynamisch dramatisch werden. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich zu den Höhen eines Aristoteles, eines Goethe oder eines Marx erheben. Und über diesem Grat werden sich neue Gipfel erheben.“
Diese Passage könnte noch im Sinne der kulturellen Entwicklung und Bildung interpretiert werden. Aber Trotzki geht noch weiter. Im selben Werk erwähnt er die Möglichkeit, auf die menschliche Biologie einzuwirken: „Sobald er mit den anarchischen Kräften seiner eigenen sozialen Organisation fertig ist, wird sich der Mensch der Aufgabe widmen, die Elemente zu beherrschen, das Wetter und das Klima zu besiegen, die Flüsse und Ozeane zu zähmen und die biologischen Arten zu verbessern, ohne seine eigene auszuschließen.“
Hier geht es nicht mehr um Kultur oder Bildung, sondern um die „Verbesserung der biologischen Arten“. Die Formulierung ist mehrdeutig, aber es fällt schwer, darin keinen Hinweis auf eugenische Praktiken zu sehen. Dass Trotzki von solchen Ideen in Versuchung geführt worden sein könnte, ist nicht so überraschend, wenn man bedenkt, dass zahlreiche progressive Intellektuelle der damaligen Zeit, darunter H. G. Wells, George Bernard Shaw und sogar Alexander Graham Bell, bestimmte eugenische Praktiken im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts befürworteten.
In ähnlicher Weise spricht Trotzki in Kultur und Sozialismus von einer Art „sozialistischer Alchemie“: „Die Psychoanalyse und die experimentelle Psychologie werden die Triebfedern menschlichen Verhaltens aufdecken. Der Mensch wird sich selbst zum Gegenstand kompliziertester Methoden künstlicher Selektion und psychophysischer Erziehung machen.“
Aus heutiger Sicht sind diese Passagen natürlich problematisch. Sie zeigen, wie sehr der Gründer der Vierten Internationale vom Szientismus seiner Zeit geprägt war und wie weit er von einem ökologischen Bewusstsein entfernt war, das notwendigerweise den Respekt vor natürlichen Prozessen und der menschlichen Vielfalt impliziert.
Eine harmonische Entwicklung aller menschlichen Fähigkeiten
Es ist interessant, diese Positionen mit denen von Bucharin zu vergleichen, der allgemein als viel rechtsgerichteter als Trotzki angesehen wird. In seinem Werk Historischer Materialismus (1921) schreibt der spätere Theoretiker der „Bereicherung der Kulaken“: „Die Gesellschaft und ihre Umwelt bilden ein System im Zustand eines (sich verändernden) Gleichgewichts. Veränderungen in dieser Umwelt provozieren Veränderungen in der Gesellschaft und umgekehrt. Wir haben also eine Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Umwelt.“ [18]
Diese Formulierung, die man heute als „ökosystemisch“ bezeichnen würde, ist viel dialektischer als Trotzkis mechanistische Vorstellungen. Bucharin geht noch weiter: Er verweist auf die Notwendigkeit einer „rationalen Regulierung des Stoffaustauschs zwischen Gesellschaft und Natur“. Dies ist ein direkter Verweis auf das marxistische Konzept des sozialen Metabolismus, das Marx insbesondere in Das Kapital entwickelt hatte.
Es sei angemerkt, dass Bucharin unter den bolschewistischen Führern nicht der Einzige war, der ein gewisses ökologisches Bewusstsein zeigte. Kautsky hatte sich bereits vor seinem Bruch mit dem revolutionären Marxismus in Die Agrarfrage (1899) [19] mit diesen Fragen beschäftigt. Aber unter den großen Persönlichkeiten des Oktobers 1917 scheint Trotzki derjenige zu sein, der diesen Anliegen am fremdesten geblieben ist.
Sicherlich erklärt der historische Kontext vieles. Die Sowjetunion war ein wirtschaftlich rückständiges Land, umgeben von Imperialismus, und die Erfordernisse der industriellen Entwicklung und Verteidigung waren dringlich. Bereits im April 1923 erklärte Trotzki in den Thesen zur Industrie, die er dem 12. Kongress der Kommunistischen Partei vorlegte, dass dies eine Frage von Leben und Tod für das Regime sei [20].
Die Fakten haben gezeigt, dass diese letzte Analyse im Grunde genommen richtig war. Angesichts der enormen Bedeutung dessen, was auf dem Spiel stand, und der zunehmend brutalen Methoden der Stalin-Bucharin-Fraktion ist es nicht verwunderlich, dass Trotzki manchmal „den Stock in die andere Richtung bog“, um einen berühmten Ausdruck zu verwenden. Zu seiner Verteidigung sei jedoch angemerkt, dass er damit lediglich der technizistischen und modernistischen Kultur der damaligen Zeit treu blieb, die von der gesamten bolschewistischen Führung geteilt wurde und ihren künstlerischen Ausdruck in der futuristischen Strömung fand [21].
Wie wir jedoch gesehen haben, erklärt der historische Kontext nicht alles. Bei einer Reihe von Fragen wie der Beherrschung der Natur, den sich daraus ergebenden Perspektiven der Transformation, der absoluten wissenschaftlichen Wahrheit, dem Status der Technologien usw. stellen wir fest, dass Trotzki hinter bestimmten, deutlich differenzierteren Positionen von Marx, Engels und sogar Lenin zurückbleibt. Sehr überraschend ist, dass einige Überlegungen zur wissenschaftlichen oder technischen Entwicklung die Dialektik als eine Art transzendente Metatheorie beanspruchen. Diese Auffassung von Dialektik steht in völligem Widerspruch zu der, die Trotzki bei seiner Analyse sozialer und politischer Phänomene zugrunde legt.
Andererseits hinterlässt der Ton der in diesem Artikel zitierten Texte sehr oft einen unangenehmen Eindruck von dominanter Arroganz, ja sogar Verachtung, nicht nur gegenüber der wilden Natur, sondern auch gegenüber dem, was natürlich, physiologisch und unkontrolliert im Menschen ist. Dieser Punkt ist wichtiger, als es den Anschein hat. Tatsächlich lassen Trotzkis sehr dominante Version der „Beherrschung der Natur” und der daraus resultierende imperativische Diskurs keinen Raum für den Gedanken, sich um das zu „kümmern”, was existiert, obwohl dies für die Entwicklung eines ökologischen Bewusstseins und einer ökologischen Praxis unverzichtbar ist.
Als vorläufige Schlussfolgerung
Leo Trotzki ist ein großer internationalistischer Revolutionär und brillanter Denker. Wir verdanken ihm insbesondere die Analyse des Faschismus, die der Bürokratie und die Theorie der permanenten Revolution. Durch die Gründung der Vierten Internationale, als es fast „Mitternacht des Jahrhunderts” war, ermöglichte er die Weitergabe des marxistisch-revolutionären Erbes an nachfolgende Generationen. Trotzki zu lesen bedeutet, mit den Fingern die Realität der Russischen Revolution, der Kommunistischen Internationale, der revolutionären Welle am Ende des Ersten Weltkriegs und ihres Rückgangs zu berühren. Es bedeutet, den Faschismus und Stalinismus, die Volksfront, die Spanische Revolution und die Kommune von Kanton, den Niedergang des Britischen Empire und den Aufstieg des amerikanischen Imperialismus zu verstehen. Mit einem Wort: Es bedeutet, das 20. Jahrhundert zu verstehen und programmatische und methodologische Elemente zu verinnerlichen, die für die Entwicklung einer antikapitalistischen Orientierung im 21. Jahrhundert absolut unverzichtbar sind.
Aber jede Medaille hat ihre Kehrseite. Bei Trotzki ist das ökologische Bewusstsein auf dem Nullpunkt. In dem Erbe, das er seinen Nachfolgern hinterließ, fehlten die wenigen brillanten, wegweisenden Instrumente des Ökosozialismus, wie sie Marx und Engels entwickelt hatten. Die ultimative Ironie: Von allen führenden Revolutionären des Oktober war Bucharin der einzige, der dem Konzept der rationalen Regulierung des sozialen Stoffwechsels zwischen Menschheit und Natur eine gewisse Bedeutung beimaß, der Führer des rechten Flügels, der Theoretiker der Bereicherung der Kulaken und des Sozialismus in einem Land, Stalins Sprungbrett. Das reicht nicht aus, um ihn zu einem ökosozialistischen Theoretiker zu machen, weit gefehlt (wir werden darauf zurückkommen), aber es ist eine Tatsache, und diese Tatsache könnte nur dazu beitragen, zu erklären, dass die revolutionären Marxisten der Nachkriegszeit den Faden der „marxistischen Ökologie“ verloren haben.
Nachwort (2025)
Diese Kritik an Trotzkis ökologischen Grenzen sollte nicht mit einer Ablehnung seines revolutionären Erbes verwechselt werden. Im Gegenteil, gerade weil Trotzkis Beiträge zur marxistischen Theorie und Praxis unverzichtbar bleiben, müssen wir uns ehrlich mit seinen blinden Flecken auseinandersetzen. Die sehr tiefgreifende und gefährliche Störung des Stoffwechsels zwischen der Gesellschaft und dem Rest der Natur – die sich nicht nur in Klimastörungen, sondern auch im Zusammenbruch der Artenvielfalt, in der Bodenzerstörung, der Versauerung der Ozeane, der chemischen Verschmutzung und der umfassenden Störung der planetarischen Kreisläufe manifestiert – erfordert, dass die Revolutionäre des 21. Jahrhunderts ökologisches Bewusstsein von Anfang an in ihr strategisches Denken integrieren, anstatt es als nachträglichen Gedanken zu behandeln, der „nach der Revolution” angegangen werden muss.
Die Ironie ist frappierend: Trotzki, der Theoretiker der permanenten Revolution, der verstanden hatte, dass der Sozialismus nicht isoliert vom internationalen Kampf aufgebaut werden kann, hat nicht begriffen, dass der Sozialismus auch nicht isoliert von der rationalen Regulierung des sozialen Stoffwechsels aufgebaut werden kann, den Marx als wesentlich für die Freiheit des Menschen identifiziert hatte. Die Ökosozialist:innen von heute müssen seine Erkenntnisse über ungleichmäßige und kombinierte Entwicklung mit einem Verständnis der materiellen Wechselbeziehung zwischen menschlicher Gesellschaft und natürlichen Systemen verbinden – in der Erkenntnis, dass die Revolution gleichzeitig international und ökologisch sein muss, sonst wird sie weder das eine noch das andere sein.
Revolutionäre Organisationen weltweit haben heute Zugang sowohl zu Marx‘ ökologischen Erkenntnissen als auch zu 150 Jahren zusätzlicher Beweise für die systematisch zerstörerische Beziehung des Kapitalismus zur Biosphäre. Wir haben keine Entschuldigung dafür, Trotzkis technologischen Fetischismus oder seine dominierende Vision der Beziehung der Menschheit zur Natur zu reproduzieren. Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist der Aufbau einer revolutionären Bewegung, die sich ebenso kompromisslos gegen den Bruch im Stoffwechsel wie gegen die kapitalistische Ausbeutung wendet – in dem Verständnis, dass dies zwei Seiten desselben Systems sind, das radikal bekämpft werden muss.
Quelle: Red Mole 13. August 2025
P.S.
Wenn Ihnen dieser Artikel gefällt oder Sie ihn nützlich finden, erwägen Sie bitte eine Spende für die Arbeit von International Viewpoint. Folgen Sie einfach diesem Link: Spenden und geben Sie einen Betrag Ihrer Wahl ein. Einmalige Spenden sind sehr willkommen. Aber auch regelmäßige Spenden per Dauerauftrag sind für unsere weitere Arbeit von entscheidender Bedeutung. Die Bankverbindung finden Sie im letzten Absatz dieses Artikels. Vielen Dank.
Angehängte Dokumente
- the-heavy-legacy-of-leon-trotsky_a9133.pdf (PDF – 952,8 KiB) Extrakt PDF [->Artikel9133]
Fußnoten
[1] Fourth International, Ecology and Socialism, http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article7892.
[2] Fourth International, Resolution: Climate Tipping Point and Our Tasks, http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article16635.
[3] F. Engels, The Dialectics of Nature, Paris, Editions Sociales, 1968, pp. 180-181.
[4] Leo Trotzki, Literatur und Revolution.
[5] Leo Trotzki, Kultur und Sozialismus, 1927
[6] Karl MARX, Brief an Engels vom 7. Juli 1866.
[7] F. Engels, Anti-Dühring, S. 136–137.
[8] Lenin, Materialismus und Empiriokritizismus, S. 147.
[9] L. Trotsky, Mendeleev and Marxism, speech at the Mendeleev Congress, September 17, 1925, Marxists Internet Archive.
[10] Marx, Das Kapital, I, Kap. XXVIII
[11] L. Trotzki, Kultur und Sozialismus, op. cit. Marxists Internet Archive (Hervorhebung von uns).
[12] Im wichtigen Bereich der Energie beispielsweise plädierten einige Ingenieure ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dafür, Kohle als Energiequelle durch Sonnenenergie zu ersetzen. Das waren nicht nur Ideen, die in der Luft lagen: In einer ganzen Reihe von Anwendungsbereichen wurden tatsächlich effiziente Solaranlagen entwickelt. Hätte sich dieser Energiesektor durchgesetzt, hätte er das Gesicht der Welt verändert. Aber er setzte sich überhaupt nicht durch, nicht aus technischen Gründen und auch nicht immer aus Gründen der Effizienz und Kosten, sondern vor allem, weil die Kohlemonopole bereits die Macht hatten, Innovationen zu blockieren, um ihre Supergewinne zu sichern (vgl. D. Tanuro, The Impossible Green Capitalism).
[13] Marx, Engels, Die deutsche Ideologie, Marxists Internet Archive.
[14] L. Trotzki, Kultur und Sozialismus, op. cit.
[15] L. Trotzki, Wenn Amerika kommunistisch werden sollte, Marxists Internet Archive (unsere Übersetzung).
[16] L. Trotsky, Radio, science, technique and society, 1926 Marxists Internet Archive (our translation).
[17] Lenin, Die Agrarfrage und die Kritiker von Marx, Kapitel IV, Marxists Internet Archive.
[18] Bukharin, The Theory of Historical Materialism. A Manual of Marxist Sociology, ed. Anthropos, Paris, 1967.
[19] Kautsky, The Agrarian Question, facsimile reprint Maspéro, Paris 1970.
[20] L. Trotzki, Thesen zur Industrie, Marxists Internet Archive.
[21] Es fällt auf, dass die meisten Texte Trotzkis, in denen er sich zur Natur äußert, die Kultur zum Hauptthema haben. Tatsächlich ist seine Art, die Natur zu begreifen, sehr eng mit seinen Vorstellungen von Kunst verbunden, was jedoch sowohl den Rahmen dieses Artikels als auch die Kompetenzen seines Autors sprengen würde. Dies zeigt sich insbesondere in seiner lyrischen Beschwörung des Wärmekraftwerks Shatura als Kunstobjekt (als etwas Schönes).
Anmerkung zu den Fußnoten: Erklärungen wurden von uns übersetzt. Hinweise auf Quellen und Seitenzahlen wurden nicht mit den auf Deutsch erschienen Texten aktualisiert.
Der Artikel wurde in Red Mole und International Viewpoint publiziert. Wir haben ihn automatisch übersetzt und auf grobe Fehler durchgesehen.