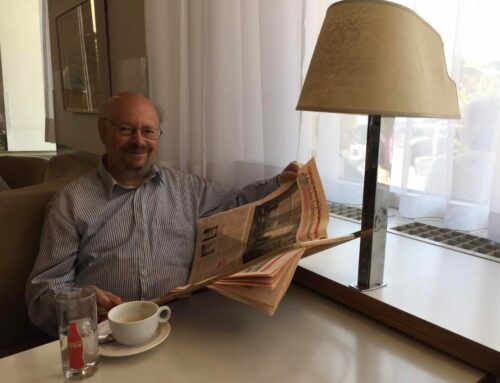Aus dem Verso-Blog: Nach den jüngsten Angriffen auf Gaza in diesem Jahr greifen wir diesen Monat einige Texte des verstorbenen Daniel Bensaïd (1946–2010) zu diesem Thema wieder auf. Diese Woche aus dem November 2000 über das Schweigen der Akademiker:innen und seine Kritik als Antizionist:
Wer hat ihn gebrochen? Nicht die Vase von Soissons, sondern den Friedensprozess. Die Zeitungen und Medien stellen die zweite Intifada [September 2000] im Allgemeinen als Ergebnis einer zufälligen Entgleisung des Friedensprozesses dar. Für die meisten von ihnen liegt die Schuld bei Arafat und seiner Hartnäckigkeit in den Verhandlungen von Camp David. Im besten Fall geben sie seiner Weigerung, sich den israelisch-amerikanischen Forderungen zu beugen, und Ariel Sharons Provokation vor der Al-Aqsa-Moschee gleichermaßen die Schuld.
Darüber hinaus hatten wir das Glück, die unrealistischsten Argumente über die getöteten Teenager zu lesen und zu hören, die Steine geworfen hatten: Anscheinend sind ihre Eltern schuld an ihrem Tod, die ihre Kinder zu Hause hätten behalten sollen. Das setzt bereits voraus, dass sie sich stattdessen zu einem gemütlichen Abend am Kamin mit dem Fernseher hätten zurückziehen können. Die meisten der 180 Menschen, die durch israelische Kugeln getötet wurden, waren jung, das ist wahr. Aber wie alt waren die Soldaten des zweiten Jahres der Französischen Revolution, die Baras und die Vialas, „deren Schicksal wir teilen möchten”, wie sie singen? Wie alt waren einige der Partisanen der Affiche rouge in der Résistance, die Thomas Eleks und Marcel Raymans? Wie alt war Gavroche? Hätte er sich nicht auf die Barrikaden begeben, sondern wäre vernünftig bei seinen Eltern zu Hause geblieben, hätte er natürlich nicht so jung sterben müssen. Die jungen Aufständischen in den besetzten Gebieten sind letztlich palästinensische Gavroches und Baras. Wenn wir von besetzten Gebieten sprechen, bedeutet das schließlich, dass diese jungen Menschen mit Besatzern konfrontiert sind, mit einer Besatzungsarmee, die sich auch so verhält. Wer kann ihnen dann ihr Recht auf Widerstand verweigern?
Es ist also eine falsche Symmetrie, die Politik des Pontius Pilatus, sich aus allem herauszuhalten, den Unterdrücker und den Unterdrückten nebeneinander zu stellen und beide der „Gewalt” zu bezichtigen!
Diese Explosion ist weder ein Unfall noch eine Ausnahme. Im Gegenteil, was wir hier haben, passt voll und ganz in die Chronik einer lange vorhergesehenen Tragödie. Schließlich begann die Geschichte weder in Camp David noch vor der Al-Aqsa-Moschee.
Jeder kann sich an den historischen Handschlag zwischen Rabin und Arafat erinnern, während Clinton mit paternalistischem, wohlwollendem Blick zusah. Die Osloer Verträge wurden oft als Beginn des Friedensprozesses gepriesen. Doch es handelte sich um ungerechte Verträge, einen ungleichen Tausch zwischen ungleichen Partnern. Während die Palästinenser den Staat Israel anerkannten, erkannte Rabin nur die palästinensischen Vertreter als legitime Gesprächspartner an, ohne ihr Recht auf Selbstbestimmung und ihr Recht auf einen souveränen Staat anzuerkennen. Er stimmte zu, dass sie eine autonome Verwaltung in Gaza und Jericho haben könnten, jedoch nur unter Aufsicht und mit begrenzter Souveränität. Die brisante Frage Ost-Jerusalems wurde auf später verschoben, während das Thema Siedlungen gänzlich ausgeklammert wurde. Und was das Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr betraf, so stand es offensichtlich außer Frage, dieses Thema anzusprechen.
Dieses ungerechte Abkommen wies jedoch gewisse widersprüchliche Aspekte auf. Die Palästinenser begrüßten es, weil es trotz seiner Einschränkungen ihre Anerkennung und Legitimität auf der internationalen Bühne stärkte. Darüber hinaus konnte es durch den Bruch mit der Logik des Krieges auch zu einer Differenzierung innerhalb der israelischen Gesellschaft und zum Wachstum der Friedensbewegung beitragen.
Dennoch handelte es sich um ungerechte Abkommen, die aus einem unausgewogenen Kräfteverhältnis resultierten. Es lohnt sich in der Tat, einige der Hauptmerkmale der internationalen Lage zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1993, in Erinnerung zu rufen.
Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zerfall der UdSSR war das sogenannte sozialistische Lager gerade zusammengebrochen. Sicherlich war es nie der beste Unterstützer der palästinensischen Sache gewesen, da es die Teilung befürwortete. Aber zumindest hatte der konfliktreiche Charakter der internationalen Beziehungen den Palästinensern einen gewissen Handlungsspielraum verschafft.
Zwei Jahre nach dem Golfkrieg war die amerikanische Hegemonie gefestigt, und die Mehrheit der arabischen Regime – allen voran Saudi-Arabien und Ägypten – hatte sich der neuen Pax Americana angeschlossen.
Nationale Befreiungsbewegungen und Antiimperialismus waren fast weltweit auf dem Rückzug, während die europäische Arbeiterbewegung von der liberalen Konterreform getroffen worden war.
Schließlich war auch die palästinensische Bewegung selbst geschwächt aus der Niederlage bei der Belagerung von Beirut 1982 hervorgegangen, auch wenn die erste Intifada der Bevölkerung der besetzten Gebiete die Initiative zurückgegeben hatte.
Die Osloer Verträge waren also in der Tat sehr ungerecht. Die Frage war jedoch, inwieweit es möglich sein würde, diese ungerechten Verträge sinnvoll zu nutzen. Das hing im Wesentlichen von der Mobilisierung vor Ort, in den besetzten Gebieten und in Israel selbst, aber auch vom Ausmaß der internationalen Solidarität ab.
Aber so wie Che Guevara vor langer Zeit sagen konnte, dass die Vietnamesen „tragisch allein“ seien, bedeutete das internationale Kräfteverhältnis Anfang der 1990er Jahre die „tragische Einsamkeit der Palästinenser“. So können wir verstehen, warum ihre Führer die Karte des Kompromisses spielten. Sie standen in einem Wettlauf gegen die Zeit. Die säkulare palästinensische Nationalbewegung, die aufgrund der zunehmenden Zahl von Siedlungen – ein Versuch, eine neue und unumkehrbare „Tatsache vor Ort” in den besetzten Gebieten zu schaffen – nicht in der Lage war, sich zu bewegen, riskierte eine Niederlage. Daher musste sie die geringste Chance für eine embryonale wirtschaftliche Entwicklung nutzen, die eine gewisse „Normalisierung” der gelähmten und entwurzelten palästinensischen Gesellschaft ermöglichen würde.
Wir wussten, dass dies nach sieben Jahren Friedensprozess kommen würde. Nicht nur wuchs die Zahl der Siedlungen kontinuierlich (unabhängig davon, ob Likud oder Labour an der Macht waren), sondern sie verdoppelte sich praktisch (auf etwa 350.000 Siedler). Ebenso nahmen die Gebietsabtrennungen, die Umgehungsstraßen, die Straßensperren und die Genehmigungen, die wirtschaftliche Überwachung, die täglichen Schikanen und die Kontrollen von Wasser und Benzin zu. Es gab eine ununterbrochene Abfolge von Demütigungen, Misshandlungen und Frustrationen. Darüber hinaus gingen die Israelis das kalkulierte Risiko ein, dass sie durch die Übertragung der Aufrechterhaltung der Ordnung – als Hilfsorganisation der IDF – als vorrangige Aufgabe an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) einen neuen Aufschwung des Islamismus fördern könnten, indem sie die PA als Komplizin der Besatzer erscheinen ließen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die zweite Intifada als vorhersehbare Explosion und nicht als Ergebnis einer Verschwörung oder von Anweisungen von oben. Es ist sogar überraschend, wie viel Geduld die Massen gezeigt haben, nachdem sie mit so vielen Friedensversprechen auf die Folter gespannt worden waren.
In einem ungleichen Kampf stehen sich Steine werfende Jugendliche und Panzer, Kampfhubschrauber und Scharfschützen gegenüber. Recht und Vernunft sind hier nicht symmetrisch, ebenso wenig wie die Ergebnisse. Ein Toter gegen fünfzehn oder zwanzig – oder einfach nur so viele verschwendete Kugeln, wie Bernard-Henri Levy sagen würde.
Angesichts all dieser Beweise hüllen sich die Intellektuellen in ohrenbetäubendes Schweigen. Man stelle sich vor, was sie schreiben und sagen würden, wenn die 900.000 Kosovaren fünfzig Jahre (fünfzig Jahre!) nach ihrer Flucht immer noch ein geächtetes Volk wären, das in Flüchtlingslagern leben müsste! Warum verfallen diejenigen, die sich hier für die nationalen Rechte der Bosnier, Kosovaren oder Tschetschenen eingesetzt haben, plötzlich in ohrenbetäubendes Schweigen? Finkelkraut sagt uns, dass alles sehr kompliziert sei, dass er nichts sagen könne, auch wenn er es doch tut. Glucksmann schweigt auffällig. Und was BHL angeht, nun, zumindest kann man sagen, dass er offen genug ist, um sich für Israel über alles auszusprechen. Es ist einfach, kein Problem, die Bosnier und Tschetschenen anzuschauen und sich für sie einzusetzen. Das kann sogar eine vorteilhafte Haltung sein. Ohne Kosten, ohne Risiko. Das wird keine Probleme mit Verlegern, Journalisten oder wem auch immer verursachen, die Ihnen Ihr Gehalt zahlen. Aber wenn es um Israel und Palästina geht, riskiert man, zur persona non grata zu werden, in Auseinandersetzungen verwickelt zu werden, bei denen es nicht nur um Meinungen geht. Man riskiert, Beziehungen, Unterstützung und Goodwill zu verlieren.
Le Monde hat eine so energische Kampagne auf dem Balkan geführt und lautstark gefordert, dass die Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden müssen – und doch ist es plötzlich zurückhaltend, wenn es um die Chefs des israelischen Generalstabs geht. Sein Chefredakteur, der ein Buch mit dem Titel L’Épreuve [„Die Prüfung“] geschrieben hat, um zu erklären, inwieweit uns der Balkankonflikt betrifft und unsere Aufmerksamkeit erfordert, inwieweit er uns umfassendere Lehren über unsere Epoche vermittelt und einen wichtigen politischen Wendepunkt darstellt, wird möglicherweise kein L’Épreuve 2 schreiben, um uns über die Bedeutung und die umfassendere Wichtigkeit der „Qual“ der Palästinenser zu informieren.
Warum dieses Schweigen? Warum diese Doppelmoral? Das Gespenst des Völkermords an den Juden mag dies erklären, aber es kann es niemals rechtfertigen. Erstens, weil die Vernichtung der Juden in den Lagern keine jüdisch-arabische Angelegenheit war, sondern eine zu 100 Prozent europäische Angelegenheit, genauso wie die Dreyfus-Affäre eine rein französische Angelegenheit war. Auch weil die Tatsache, Opfer gewesen zu sein, niemanden dazu berechtigt, seinerseits ein anderes Volk zum Opfer zu machen: Das erlittene Leid gibt kein unbegrenztes Recht auf ein gutes Gewissen.
Wir müssen endlich diesen Teufelskreis durchbrechen, in dem das schlechte Gewissen der einen das gute Gewissen der anderen besorgt. Unter anderen Umständen würden wir das Kind beim Namen nennen und die von den israelischen Regierungen verfolgte Abtrennungspolitik als das bezeichnen, was sie ist: Apartheid. Unter anderen Umständen würden wir die während des Krieges von 1948–49 praktizierte „Transferpolitik” (die heute von Historikern wie Morris und Pappe dokumentiert ist) als das bezeichnen, was sie ist: ethnische Säuberung. Und Deir Yassin, Kafr Qasim, Tel al-Zaatar sowie Sabra und Shatila würden als ebenso viele Oradour-sur-Glanes betrachtet werden.
Auf dem Weg in die Katastrophe wird ein vielleicht unumkehrbarer Schritt getan. Einige wollten in der ethnischen Entartung des Balkankonflikts nur das Ergebnis des Zerfalls der bürokratisch-nationalistischen (oder, wie sie es nannten, „kommunistischen”) Regime sehen. Wir betonten damals, dass es sich leider nur um eine besondere Form einer allgemeineren Tendenz zur Rassifizierung, Ethnisierung und Konfessionalisierung der Politik handelte, wie sie in Afrika in der Region der Großen Seen und heute im Nahen Osten zu beobachten ist.
Nationale Befreiungskämpfe werden zu Religionskriegen, politische Konflikte zu kommunalen oder Stammeskonflikten. Dies ist die Kehrseite, die Rückseite der imperialen Globalisierung: Nationale Bestrebungen entfernen sich von der politischen Souveränität und richten sich stattdessen auf die Suche nach Ursprüngen, einer genealogischen Legitimation, einer Archäologie. Dies gilt insbesondere für Israel und Palästina, die reich an Symbolen sind. Wohin führt uns das, wenn Israels religiöse Führer die Vertreibung der Palästinenser mit der chronologischen Rangfolge des Salomonischen Tempels oder des Grabes Josephs gegenüber der Al-Aqsa-Moschee rechtfertigen? Dann ist alles möglich. Vielleicht kommt ein katholischer und papistischer „dritter Räuber“ und sagt den Israelis, dass sie wegen der Kreuzigung immer noch Blut an ihren Händen haben!
Diese Logik kommt in der Tat im Prinzip des Rückkehrrechts zum Tragen, das jedem Juden aus der Diaspora ein Blutrecht einräumt, während es den seit 1948 vertriebenen Palästinensern das mit dem jus soli verbundene Rückkehrrecht verweigert.
Deshalb ist es von größter Dringlichkeit, dass wir uns wieder auf die politische Grundlage, die politische Bedeutung und die Herausforderungen dieser Konflikte besinnen. Nein, dieser Streit ist kein Gegensatz zwischen zwei Lagern, zwei Gemeinschaften, zwei Identitäten, zwei Religionen. Er durchdringt diese Identitäten, er ist größer als sie.
Angesichts des Aufrufs der kommunalen Institutionen an „alle Juden” in Frankreich und anderswo, sich hinter Israel und seine Führer zu stellen, sowie der Identifizierung der gesamten Diaspora mit dem jüdischen Staat und aller Juden mit dem Zionismus, werden junge Palästinenser und junge Araber in den Banlieues ihnen schließlich glauben und so die Synagogen und die israelischen Botschaften, den Antizionismus und den Antisemitismus miteinander verwechseln. Ja, nachdem der Antisemitismus einst der „Sozialismus der Dummköpfe“ war, könnte er nun zum „Antiimperialismus der Dummköpfe“ werden. Und das wird die symbolische Ursache und Identität der Rebellen ohne Grund in den Banlieues sein, die unter Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und schlechten Bildungsabschlüssen leiden.
Aus diesem Grund haben wir die ungewöhnliche und außergewöhnliche Initiative ergriffen, einen gemeinsamen Appell „als Juden“ zu unterzeichnen. Ohne dass es auch nur die geringste Abstimmung gegeben hätte, sind ähnliche Initiativen in den Vereinigten Staaten, England, Kanada und Australien entstanden. Ich selbst betrachte mich in erster Linie als säkularen und internationalistischen Aktivisten. Während Finkelkraut uns also „als Nichts“ attackiert hat, kann ich ihm als weniger als Nichts antworten – wenn er dabei bleiben will, ein Nichts zu sein. Diese kosmopolitische Staatsbürgerschaft bedeutet jedoch keineswegs, dass ich meine Herkunft leugne oder verberge. Es gibt also zwei Situationen, in denen ich mein Judentum bekräftigen kann: gegenüber einem Antisemiten und gegenüber einem Zionisten.
Adjektivisch jüdisch, das heißt: nicht als „Jude“, als wäre das mein Wesen, sondern jüdisch in einem bestimmten Kontext, in Bezug auf eine bestimmte Situation. Ein mutierter Jude, ein jüdischer Nichtjude, könnte man sagen. Ein „Spinozant“, wie Edgar Morin es schön formuliert hat. Jüdisch im Sinne eines dissidenten, kritischen Geistes, als Herausforderung.
Ich bin erschüttert darüber, wie der Diskurs der israelischen Führung alle Opfer des Völkermordes an den Juden und alle Juden in der Diaspora für ihre eigene politische Sache vereinnahmt und einspannt, und auch darüber, wie sie die Sprecher:innen der jüdischen Gemeinden zu einer solchen Identifikation – und damit zu Komplizenschaft – auffordern. Das ist einfach inakzeptabel. Es ist eine Verletzung und eine Untergrabung des Erbes. Es ist ein Raub, eine private Aneignung des kollektiven Leidens und der kollektiven Erinnerung. Zweifellos gab es unter den Deportierten Zionisten, aber es gab auch viele Kommunisten, Bundisten, Trotzkisten und Menschen ohne politische Zugehörigkeit. Wie viele andere habe ich ein gutes Dutzend Tanten, Onkel und Cousins, die nie zurückgekehrt sind. Sie waren politisch nicht engagiert. Ich sehe nicht, inwiefern ihr Leidensweg als Rechtfertigung für die heutige israelische Politik dienen kann. Die Juden und Jüdinnen der Internationalen Brigaden, darunter auch diejenigen der Botwin-Brigade, nahmen nicht am Spanischen Bürgerkrieg teil, um einen jüdischen Staat im Land Israel zu gründen. Sie taten dies, um den Faschismus zu bekämpfen – zweifellos als Juden/ Jüdinnen, aber auch untrennbar und unteilbar als Kommunist:innen, als Trotzkist:innen, als Proletarier:innen, Schneider:innen oder Hutmacher:innen. Auf jeden Fall war der Zionismus vor dem Krieg keine mehrheitsfähige Sichtweise.
Die Gemeinschaftslogik hat eine unbegrenzte Neigung zu Aneignung und Usurpation. Sie kann alles unter ihre Fittiche nehmen. Auch Bernard Lazare! Aber lesen und wiederlesen Sie sein Werk Le Fumier de Job. Da ihn die Dreyfus-Affäre zwang, sich erneut mit seinem Judentum auseinanderzusetzen, verstand Lazare sehr gut – er wusste es aus eigener Erfahrung – die Ausflüchte, die Feigheit und die heuchlerische Unaufmerksamkeit der Gemeinschaft und der religiösen Institutionen. Er sagte, dass „die Juden erneut zerstreut und zersplittert“ seien und dass mit „dem Erwerb von Privilegien durch die Bourgeoisie und ihrer damit einhergehenden Trennung vom Volk“ die Solidarität verschwunden sei. Er forderte die Juden daher auf, sich nicht damit zufrieden zu geben, Revolutionäre „in der Gesellschaft anderer und nicht in ihrer eigenen“ zu sein. Er forderte sie auf, sich „gegen den Unterdrücker in ihrem Inneren“ zu erheben. Er sprach mit gnadenlosen Worten von Wut, Gerechtigkeit und Prophezeiung: „Ihr umarmt die Reichen unter euch zu fest, ihr könnt nichts anderes mehr sehen! Ihr wendet euch an eure Priester; ihr vergesst, dass es in Israel keine Priester gibt. Ihr seid keine Juden mehr, sondern Elende.“ Und er war kein Zionist: „Unsere Heimat besteht aus so vielen Dingen, so vielen Erinnerungen, so vielen Bedauern und Freuden, so vielen Klagen und Schmerzen, dass ein kleines karges und ödes Stück Land sie niemals tragen könnte. Jerusalem oder Judäa sind nur ein Teil unserer Heimat.“
Deshalb schrieben wir als Juden, gegen die Vereinnahmung, gegen die Aneignung der Lebenden und der Toten, gegen das staatliche Monopol der Erinnerung. Vor allem aber, um Dinge voneinander zu trennen, die manche Menschen zu verwechseln hoffen, und um zwischen Dingen zu unterscheiden, die sie gleichsetzen wollen. Um zu zeigen, dass Juden und Israel, Juden und die israelische Führung, Juden und die Politik der israelischen Führung nicht alle dasselbe sind: Es ist nicht nur sechs von dem einen und ein halbes Dutzend von dem anderen. Das heißt, wir können uns als Juden und Jüdinnen gegen solche Politiken stellen. Das bedeutet, dass wir uns nicht in die Zugehörigkeit zu einer „Gemeinschaft“ einschließen lassen und nicht akzeptieren, im gemeinschaftlichen Sumpf unterzugehen. Es bedeutet, Zwietracht und Dissens zu säen. Es bedeutet, zu zeigen, dass wir, wenn wir uns auf das Terrain der politischen Vernunft und nicht der religiösen Unvernunft begeben, wenn wir das Problem in säkularen, politischen Begriffen angehen, wenn wir einen anderen Faden der Solidarität jenseits der Grenzen, der Glocken und Kapellen suchen, wenn wir einen anderen Teil von uns selbst unter den „Anderen” sehen wollen, dann fühlen wir – ich – mich einer Leila, einem Elias, einer Camille, einem Edward Said näher als einem Rabbi Sitruk, einem Laurent Fabius oder einem Dominique Strauss-Kahn. Und ich hoffe, dass sich Leila, Elias und die anderen mir näher fühlen und erkennen, dass sie viel mehr mit mir gemeinsam haben als mit den Mubaraks, den Ben Alis und den saudischen Ölmonarchen. Das allein ist schon ein Fortschritt.
Wir haben in einer ungewöhnlichen Situation einen ungewöhnlichen Schritt getan. Etwas, was wir nicht getan haben, was wir uns vor zwanzig Jahren nicht einmal hätten vorstellen können. Aber ich bin versucht zu sagen, dass wir dazu reduziert worden sind, dass wir aufgrund der Resignation anderer Menschen, ihrer Verantwortungslosigkeit, auf diese symbolischen Gesten reduziert worden sind. Wo ist die Arbeiter:innenbewegung geblieben? Und was ist mit der Linken? Was ist von der internationalen Solidarität übrig geblieben?
Also haben wir als Juden und Jüdinnen geschrieben, weil wir keine andere Wahl hatten. Aber nicht nur, weil wir Juden und Jüdinnen sind – sondern auch, weil wir Juden und Jüdinnen sind. Das ist keine Selbstverleugnung oder Verrat – im Gegenteil, es ist auch wegen unserer Sorge um das Schicksal der Juden und Jüdinnen in Israel, um ihre Sicherheit, um ihre Zukunft.
Übersetzt aus dem Französischenvon David Broder für Verso und dort ursprünglich veröffentlicht am 9. Oktober 2014.
Der ins Englische übersetzte auf International Viewpoint wiederveröffentlichte Text aus 2014 wurde von uns maschinell übersetzt und auf grobe Fehler durchgesehen.