von Elfriede Müller (sie war auch Referentin beim Sommerseminar der SOAL 2025)
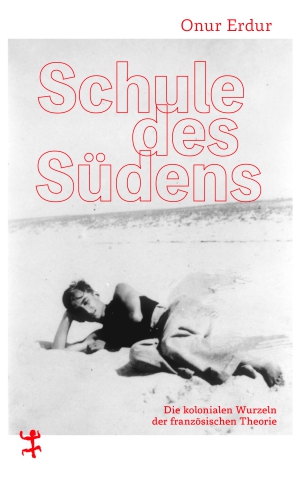 Onur Erdur: Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie. Berlin: Matthes und Seitz, 2024. 336 S., 28 Euro
Onur Erdur: Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie. Berlin: Matthes und Seitz, 2024. 336 S., 28 Euro
Viele bekannte französische Theoretiker:innen der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts haben auf die eine oder andere Art einen »kolonialen Hintergrund« mit einer konkreten biografischen Realität. Der Historiker und Kulturwissenschaftler Onur Erdur untersucht in seinem unterhaltsamen und bebilderten Essay genau diese individuellen räumlichen Erfahrungen und ihren Einfluss auf die Theorie. Es waren nicht nur die legendären Pariser Bibliotheken, sondern auch die Straßen Algiers und der Strand von Tunis, die den Raum für Theorie bildeten.
Es geht Erdur nicht nur um in Theorie gegossene Erfahrungen, sondern auch um die Verantwortung der Intellektuellen in kolonialen Zeiten: Wie verhielt man sich gegenüber dem kolonialen Unrecht, von dem nicht selten profitiert wurde? Die Intellektuellen kamen meistens als Repräsentanten des Militärs oder des Bildungssystems aus der Metropole in die Peripherie, oder sie waren Teil der europäischen Kolonialbevölkerung.
Historisch konkret analysiert Endur die lokalen, historischen und individuellen Kontexte seiner Protagonisten. Die Dekolonisierung prägte in dieser zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts die französischen Intellektuellen. Die Fortschrittsidee mit ihrem universalistischen Anspruch hatte Schaden genommen, da dieser bisher nicht für die Kolonialbevölkerungen galt, auch wenn es in der Französischen Revolution und vor allem in der damit verbundenen Haitianischen Revolution so intendiert war. Endur geht so weit zu behaupten, ohne die kolonialen Erfahrungen wären die Hauptwerke der französischen Theorie nicht entstanden und nicht zu verstehen.
Das Buch hat vier Teile: Im ersten Teil stehen Pierre Bourdieu und Jean-François Lyotard zur Debatte, die sich beide bereits in den 50er Jahren in Algerien aufhielten. Darauf folgen Roland Barthes und Michel Foucault, dann Jacques Derrida und Hélène Cixous, beide jüdische Algerienfranzosen. Zum Schluss Étienne Balibar und Jacques Rancière.
Pierre Bourdieu wurde 1955 mit fünfundzwanzig Jahren nach Algerien zum Militärdienst einberufen und blieb für fünf Jahre im Land. In dieser Zeit wandelte sich der ausgebildete Philosoph zu einem der wenigen linken Soziologen Frankreichs. Bourdieu war der erste, der von der algerischen Bevölkerung als eigenständiges Subjekt sprach.
Jean-François Lyotard bestimmte mit Das postmoderne Wissen die Debatten der 80er und 90er Jahre in Frankreich. Das augenscheinliche koloniale Unrecht machte ihn zum Unterstützer der Algerischen Unabhängigkeitsbewegung.
Seine postmoderne Theorie kündete davon, die großen Erzählungen der Moderne seien überholt, der Niedergang ihrer Werte zeige sich im algerischen Kolonialsystem. Lyotard trieb ein Leben lang auch die Schuldfrage um, die Verantwortung, die Menschen wie er in diesem Kolonialsystem hatten.
Für Michel Foucault stellte sich die Frage von Schuld und Verantwortung nicht. Anders als Bourdieu und Lyotard war er auch kein Linker. 1966, dem Jahr, in dem Die Ordnung der Dinge erschien, wechselte er an die Universität von Tunis, weil ihn die revoltierenden Studierenden in Paris nervten und seine Vorlesungen störten; dann gab es Streit mit Jean-Paul Sartre, der ihn als »Bollwerk der Bourgeoisie« bezeichnete. Endur sieht in Foucaults Lebensstil in Tunesien »karikaturhafte Züge eines schlechten französischen Kolonialfilms«.
Hélène Cixous ist die einzige erwähnte Frau. Ihre feministischen Ansätze ragten aus den Herangehensweisen ihrer Kollegen heraus. Sie wurde 1937 in Algerien geboren und ist Schriftstellerin und Hausdramaturgin des international renommierten Théâtre du Soleil.
Mit ihrem feministischen Manifest Das Lachen der Medusa gelang ihr 1975 der internationale Durchbruch. Sie erfand auch den Begriff der weiblichen Schreibweise, woraufhin ihr ein Essentialismus des Weiblichen vielleicht nicht zu Unrecht vorgeworfen wurde.
Étienne Balibar ist 1942 geboren, war immer Philosoph und Aktivist und setzt sich seit den 1970er Jahren für Migrant:innen in Frankreich ein. Theoretisch arbeitet er zu Migration, Nationalismus und Kolonialismus – eine Folge seiner Erfahrung mit dem Algerienkrieg und seinem zweijährigen Aufenthalt im unabhängigen Land.
Er gehörte zu den jungen Leuten, die sich aus der PCF heraus gegen den Algerienkrieg organisierten. Sie prägten die Ereignisse von 1968 und die gesamte außerparlamentarische Linke der Jahre danach. Balibar zog für zwei Jahre nach Algerien und unterrichtete Philosophie an der Universität von Algier. Bis heute treibt ihn die Frage um, wieso lassen sich Nationalismus und Rassismus nicht besiegen?
Onar Endur hat mit Schule des Südens eine theoretische und historische Lücke geschlossen: er hat die Prägung der französischen Gesellschaft der Nachkriegszeit auch in der französischen Theorie transparent gemacht. Die bis heute nicht vollzogene Dekolonialisierung der Metropole findet ihren deutlichsten Ausdruck im Erstarken der faschistischen Bewegung und drückt sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise auch in der Theoriebildung des Marxismus, des Strukturalismus und Poststrukturalismus aus.
Der Algerienkrieg bedeutete für die meisten französischen Intellektuellen dieser Zeit eine Zäsur. Ob sie sich dagegen engagierten, darunter litten oder davon profitierten, seziert Onar Endur fein heraus. Welche Rolle dabei Orientalismus, Antimilitarismus und Antikolonialismus spielten, ist manchmal überraschend.
Die vernachlässigten Wurzeln der französischen Theoretiker:innen offen zu legen, ist Endur gelungen, jedenfalls handelt es sich keineswegs allein um französische Theorie, sondern um eine, die ohne den Süden nie so entstanden wäre.
Der Artikel erschien in der SOZ, Sozialistische Zeitung Okt. 2025 https://www.sozonline.de/2025/10/die-strassen-von-algier/



